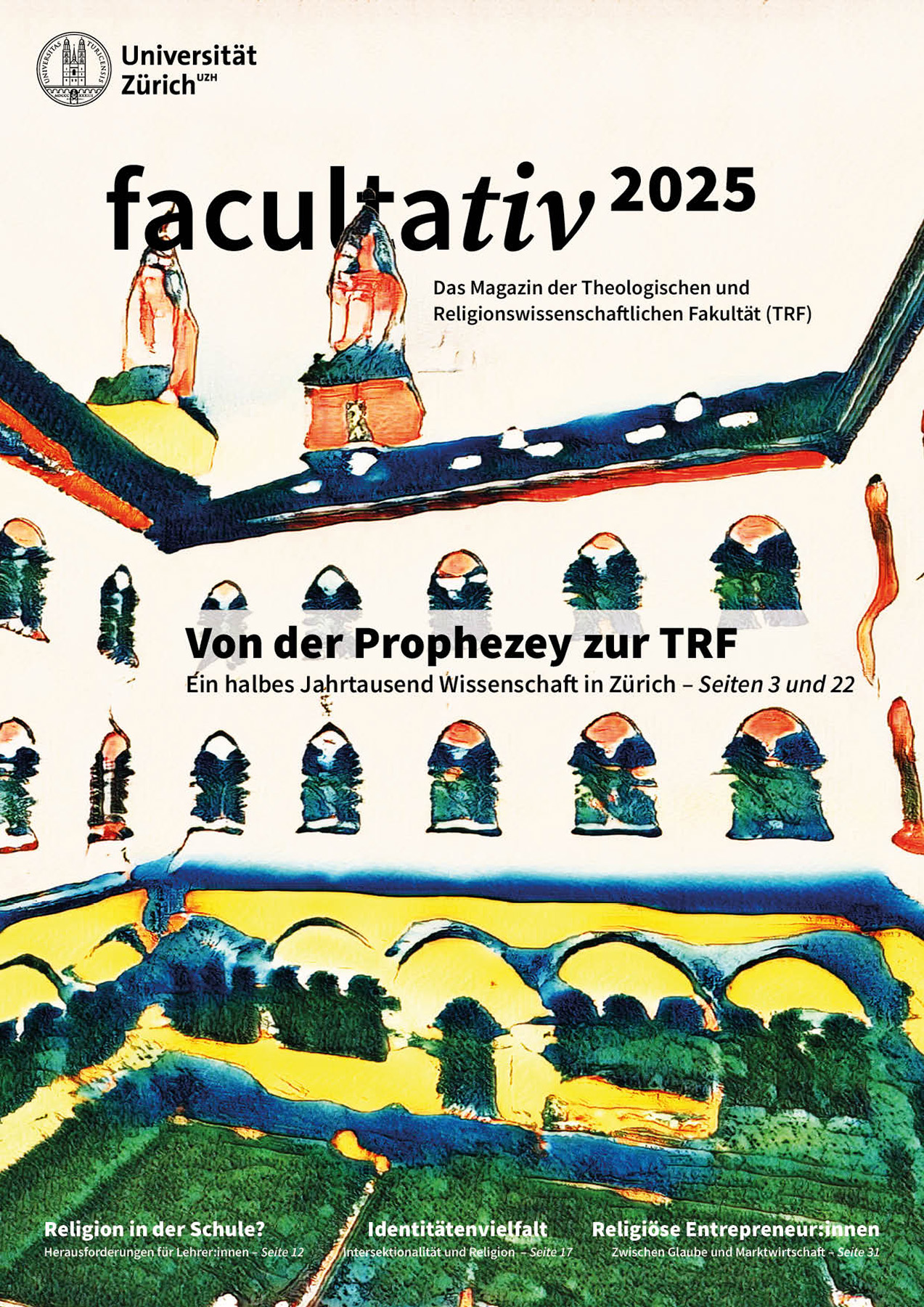Religion in der Schule?
Herausforderungen in der Ausbildung zum Schulfach «Religionen, Kulturen, Ethik»
Religionen, Kulturen und Weltanschauungen spielen auch im 21. Jahrhundert eine grosse gesellschaftliche Rolle und ein kompetenter, toleranter und kritischer Umgang mit religionsbezogenen und ethischen Fragen ist für unser Zusammenleben zentral. Die dafür notwendigen Kompetenzen soll das Schulfach Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) vermitteln, das u. a. in der Sekundarstufe I angeboten wird. Für Lehrpersonen ist der RKE-Unterricht eine vielschichtige und anspruchsvolle Tätigkeit, auf die sie auch im Rahmen einer fachwissenschaftlichen Ausbildung am Religionswissenschaftlichen Seminar der UZH vorbereitet werden.
Von Lea Sara Mägli

Im gesellschaftlichen Diskurs wird oft davon ausgegangen, dass wir uns in einem Zeitalter der Säkularisierung befinden und die Beschäftigung mit der Thematik Religion daher obsolet ist. Besonders erklärungsbedürftig ist aus dieser Perspektive, weshalb es ein obligatorisches Schulfach wie Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) braucht. Bei genauerer Betrachtung wird aber deutlich, weshalb Schulunterricht, der sich mit Religionen, Kulturen und ethischen Fragen beschäftigt, nicht nur seine Berechtigung hat, sondern sogar stets an Bedeutung gewinnt und letztlich unverzichtbar ist, gerade in Zeiten von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, KI und Fake News.
So kann das Schulfach RKE Kindern und Jugendlichen dabei helfen, in einer weltanschaulich und religiös pluralen Gesellschaft ihre Teilhabe aktiv zu gestalten und ihre Rechte einzufordern (auch später als Erwachsene). Sie lernen zum Beispiel, dass sie das Recht haben, frei von (religiös und kulturell bedingter) Diskriminierung zu leben, ihnen wird aber auch vermittelt, dass sie andere Ansichten respektieren müssen. Ebenso geht es darum, den gesellschaftlichen und medialen Diskurs mit Bezug zu Weltanschauungen, Kulturen und Religionen zu verstehen und kritisch zu hinterfragen. Dabei mangelt es nicht an Beispielen, die uns allen immer wieder begegnen: Seien es Abstimmungen (etwa zum Burkaverbot), religiöse Influencer:innen, religionsbezogener Rassismus und Diskriminierung wie antimuslimischer Rassismus oder auch Antisemitismus oder globale Konflikte, wie der aktuelle Nahostkonflikt, in welchem Religion immer wieder als Deutungsmuster erscheint.
Die obligatorische Volksschule, welche eine Mehrheit der Bevölkerung durchläuft, ist der ideale Ort, um Kompetenzen im Umgang mit solchen Phänomenen und Fragen zu erlernen und das Miteinander in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft einzuüben.
Reflektierter und offener Umgang mit Religionen – in Gesellschaft und Schule
Schüler:innen und Lehrer:innen tragen ihre Vorstellungen von Religion(en) und Weltanschauungen sowie ihre persönlichen Überzeugungen diesbezüglich – oft unbewusst – in den Raum Schule, was Forschung mit Lehrpersonen bereits zeigen konnte.[1] Dabei zeigt sich eine grosse Pluralität an Religionen und Weltanschauungen, die in einer Klasse zusammenkommen, wozu religionsablehnende Haltungen genauso gehören wie affirmative, also religionsbejahende. Hier gilt es einen Modus für ein respektvolles Zusammenleben zu finden. Es stellen sich im Kontext Schule aber auch sachbezogene Fragen, die bei Weitem nicht nur den RKE-Unterricht betreffen, z. B.: Darf eine Lehrperson sichtbare religiöse Symbole tragen? Wie weit soll den Schüler:innen das Ausüben ihrer Religion gestattet sein während dem Schulalltag? Wie ist mit Dispensationswünschen und der Ablehnung gewisser im schulischen Alltag verankerter Handlungen umzugehen, die von den Betroffenen religiös und/oder kulturell begründet werden? Wie hat sich der Schulalltag etwa während Ramadan und anderen nicht-christlichen Feiertagen anzupassen? Und ganz allgemein: Wie wird Schule zu einem multi-weltanschaulichen Raum, der nicht weiterhin einen monoreligiösen christlichen Habitus[2] befördert, und damit viele ausschliesst, auch jene, die sich keiner Religion zugehörig fühlen? All diese Fragen stellen sich an Schulen ganz konkret und explizit, weshalb eine differenzierte und adäquate Ausbildung der Lehrpersonen von kaum zu überschätzender Bedeutung ist. Vermittelt werden die entsprechenden Kompetenzen in den Modulen zu Religionen, Kulturen, Ethik an der Universität Zürich.
Praxisnahe fachwissenschaftliche Module an der UZH
Wer das Schulfach Religionen, Kulturen, Ethik (RKE) an der Volksschule unterrichten möchte, muss dafür das entsprechende Lehrdiplom an der Pädagogischen Hochschule Zürich absolvieren. Dieses enthält im Fall der Sekundarstufe I (in Zürich: Sekundarschule) auch eine fachwissenschaftliche Ausbildung an der Universität Zürich im Umfang von 15 ECTS.
Dafür besuchen die künftigen Lehrer:innen an der UZH insgesamt fünf Module. Die Module in den ersten Semestern dienen dabei insbesondere dem grundsätzlichen Kompetenzerwerb und der Einführung in eine religions- und kulturwissenschaftliche Denkweise. Dabei geht es jedoch längst nicht nur um Religion(en), sondern auch um nicht-religiöse Weltanschauungen, die unsere heutige Welt prägen. Gesellschaftliche Entwicklungen werden thematisiert und aufeinander bezogen, etwa Fragen nach dem Umgang mit Lebensstilen und Geschlechterrollen. Ein Modul ist ausserdem dem Teilbereich Ethik gewidmet. Im Abschlussmodul wird eine selbständige Projektarbeit mit Schulbezug erarbeitet. Beispiele aus den vergangenen Jahren beschäftigten sich etwa mit Ramadan in der Schule, religiösem Marketing, Berichterstattungen über Gewalttaten mit möglichen religiösen Motiven, dem Zusammenhang des Fachbereiches Wirtschaft, Arbeit, Haushalt mit RKE, Kleiderregelungen an Schulen, frauenfeindlichen Narrativen in Social-Media-Content sowie mit gesellschaftsrelevanten ethischen Fragen wie dem Umgang mit dem Thema Tod oder Abtreibung.
Die fachwissenschaftliche Ausbildung für das Schulfach Religionen, Kulturen, Ethik befindet sich dabei in stetem Wandel und wird permanent überarbeitet und verbessert. Vor einigen Jahren wurde die Ausbildung grundlegend reformiert, indem eine Abkehr vom Weltreligionenparadigma[3] stattfand. Dazu wurden die bis dahin bestehenden Einführungskurse in einzelne Religionen aufgelöst und Module etabliert, die von grundlegenden religions- und kulturwissenschaftlichen Kompetenzen ausgehen und allgemeine Fragen rund um Religionen und Ethik exemplarisch an Beispielen aus verschiedenen Weltgegenden und Kulturen behandeln. Dabei werden aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Ereignisse ebenso zum Thema wie die Religionslandschaft Schweiz.
Die Studierenden erhalten in der fachwissenschaftlichen Ausbildung nicht nur fundiertes theoretisches Wissen, es geht explizit auch um die Fragen, die sie im Zusammenhang mit religiösen und ethischen Themen im Schulalltag unmittelbar beschäftigen: Wie reagieren, wenn Jugendliche Äusserungen machen, die gewisse Gruppen diskriminieren, und sie sich dabei auf ihre Religion berufen? Wie ist mit Antisemitismus und (religionsbezogenen) Rassismen umzugehen? Wie verhalte ich mich, wenn Ansichten geäussert werden, die heikle ethische Fragen aufwerfen? Wie kann so über Religion und Kulturen gesprochen werden, dass man deren innerer Vielfalt gerecht wird und keine Stereotype reproduziert? Wie sind gewisse weit verbreitete Begriffe wie etwa «Sekten» zu verwenden oder auch nicht? Wie lassen sich solch komplexe Themen wie Religionen, Weltanschauungen und ethische Debatten verständlich erklären, ohne normativ zu werden? Was muss ich wissen und können, um Schüler:innen bei solchen Themen zu begleiten?
Eigene Überzeugungen hinterfragen und Uneindeutigkeit aushalten
Zentrale zu erwerbende Kompetenzen sollen es den Studierenden ermöglichen, solche Fragen in der konkreten Situation adäquat zu bearbeiten – auch wenn es hier nur selten eindeutige Antworten gibt. Die künftigen Lehrpersonen sollen Normativität beim Sprechen über Religionen, Kulturen, Weltanschauungen erkennen und einen Umgang damit finden, wobei auch die Fähigkeit wichtig ist, sich in einer deskriptiven, fachwissenschaftlich angemessenen Sprache auszudrücken. Ebenfalls sehr relevant ist eine kritische Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen, Überzeugungen und «Präkonzepten», also Alltagsvorstellungen und -theorien. Es muss vermieden werden, dass alltägliche Deutungsmuster unreflektiert und unbewusst in den Unterricht eingebracht werden. Um ein entsprechendes Bewusstsein zu schaffen, werden u. a. Aussagen von Lehrpersonen aus der Forschung diskutiert und analysiert, da es leichter ist, gewisse Tendenzen zuerst bei anderen zu erkennen, bevor man sich seinen eigenen Konzeptionen stellt.
In den Modulen wird das Erkennen von verschiedenen Perspektiven eingeübt, insbesondere die Unterscheidung zwischen Selbst- und Fremddarstellungen von Religion und Kultur. Ebenso geht es um ein Erfassen von unterschiedlichen Wahrheitsansprüchen der entsprechenden Perspektiven, da für viele Studierende der wissenschaftliche Blick auf Religionen und Kulturen etwas Neues ist und sie bisher vor allem mit ihren eigenen Innenperspektiven vertraut waren. Religionen und Weltanschauungen werden historisch und sozio-kulturell kontextualisierend betrachtet. Dabei wird insbesondere Wert auf die Akteur:innenperspektive gelegt, auf gelebte Alltagspraxis, um eine Loslösung von der Idee von Religionen als Anhäufung von Symbolbeständen wie etwa Regeln oder Festen zu ermöglichen. Dazu wird aufgezeigt, dass Religionen keinesfalls statische, ahistorische Gebilde sind und wie ihre Deutungen mit gesellschaftlichen Diskursen im Austausch stehen und von verschiedenen Akteur:innen beeinflusst werden. Gerade Beispiele von Menschen, welche sich klaren Zuordnungen zu einer Religion oder Weltanschauung entziehen, zeigen dabei die mögliche Diversität auf, die Studierende auch im Klassenzimmer antreffen werden. Dabei soll auch erkannt werden, dass Religion nur ein möglicher denk- und handlungsleitender Faktor neben vielen anderen ist.
Zentral ist ebenso die grundlegende Förderung von Fähigkeiten, die im Alltag als Lehrperson von Nöten sind. Neue Themen müssen oftmals ohne Hilfe von passenden Lehrmitteln eigenständig recherchiert und aufbereitet werden. Dies erfordert nebst Recherchekompetenzen auch einen sorgfältigen Umgang mit Quellenmaterial, kritisches Denken, die Fähigkeit Relevanzsetzungen vorzunehmen und begründete Entscheidungen für oder gegen bestimmte Materialien zu fällen, indem diese auf ihre Wissenschaftlichkeit hin geprüft und die dahinterliegenden Perspektiven und normativen Ansprüche erkannt werden. Für Lehrpersonen in diesem Fach ist auch ein angemessener Umgang mit Mehr- und Uneindeutigkeiten sowie Wissenslücken und das Einüben einer Ambiguitätstoleranz zentral, denn Lehrpersonen müssen es aushalten und kommunizieren können, wenn es in bestimmten Themen und Fragen keine eindeutig richtige oder falsche Antwort gibt.
Beispiel aus einem Modul: Zum Umgang mit dem Nahostkonflikt in der Schule
Nachfolgend soll exemplarisch an einem Themenbeispiel aus einem Modul aufgezeigt werden, wie in der fachwissenschaftlichen Ausbildung im Bereich RKE an der UZH gearbeitet wird. Im zweiten Semester beschäftigt sich ein Modul mit Fragen rund um Diversität, Globalisierung und Konflikte mit Bezug zu Religionen, Kulturen und Weltanschauungen. Dabei werden auch koloniale Verflechtungen der Religionswissenschaft thematisiert, welche das Denken und Sprechen über «fremde» Religionen bis heute prägen.[4] Eine Sitzung widmet sich dabei dem Nahostkonflikt, der koloniale Bezüge aufweist, aktuell ist und in welchem in der öffentlichen Berichterstattung Religion als ein Konfliktfaktor benannt wird. In der Seminarsitzung werden auch konkrete Folgen für den Schulalltag thematisiert, etwa der Anstieg von anti-muslimischem Rassismus und Antisemitismus sowie der Umgang damit in Schulen. Einerseits wird dabei Inhaltswissen vermittelt, indem die historischen und religionsgeschichtlichen Hintergründe des Konflikts erarbeitet werden. Andererseits wird Religion als Konfliktfaktor untersucht; es wird versucht, eine Meta-Ebene einzunehmen, und schliesslich zur Analyse von gesellschaftlichen Diskursen übergegangen. Hier kann insbesondere eingeübt werden, zwischen persönlichen Meinungen und gesicherten Fakten zu unterscheiden, um vorschnelle Schlüsse zu vermeiden, welche angesichts der Komplexität der Lage nicht angemessen sind. Dazu werden aktuelle Zeitungsartikel, Social-Media-Beiträge, Leser:innenkommentare etc. analysiert und eingeordnet. Auf diese Weise schulen die Studierenden auch allgemeine Methodenkompetenzen. Sie sollen befähigt werden, das Gelernte auf andere Thematiken zu übertragen, da nie alles behandelt werden kann in der Ausbildung. Wie später in ihrem eigenen Schulunterricht geht es auch hier um exemplarisches Lernen. Anschliessend wird andiskutiert, wie die Thematik im Sekundarunterricht mit den Jugendlichen behandelt werden kann, wie also die fachwissenschaftlichen Konzepte umgesetzt werden können.
Die Leistungsnachweise und Prüfungsformate zielen dabei auf eine eigene vertiefte Auseinandersetzung mit Themen ab, wobei die gelernten Analysemethoden und Denkweisen zur Anwendung kommen sollen. Studierende entwerfen als einen möglichen Leistungsnachweis etwa ein Inhaltsverzeichnis für ein Wunschlehrmittel und begründen dies fachwissenschaftlich oder erarbeiten z. B. einen Podcast, um erlernte Konzepte im Gespräch mit anderen zu reflektieren.
Die Notwendigkeit fachdidaktischer Forschung und ein Blick in die Zukunft
Das Schulfach wird sich zukünftig weiterhin gesellschaftlichen Herausforderungen stellen und sich an sie anpassen müssen, um für Lernende einen Lebensweltbezug ermöglichen zu können. Auch neue fachwissenschaftliche Erkenntnisse müssen unbedingt aufgenommen werden, damit die Ausbildung à jour bleibt. Um das Schulfach RKE und die dazugehörige Ausbildung forschungsbasiert weiterzuentwickeln, braucht es darüber hinaus vermehrt fachdidaktische Forschung. Diese ist bisher nur marginal vorhanden, auch weil RKE im Gegensatz zu anderen Fächern noch nicht auf eine jahrzehntelange Geschichte und etablierte Standartwerke zurückgreifen kann. Dabei gilt es u. a. zu eruieren, was für Präkonzepte Schüler:innen in den Unterricht mitbringen und was für Konzepte von Religionen, Weltanschauungen und Ethik Lehrpersonen haben. Es stellt sich insbesondere die Frage, was in der sogenannten Didaktisierung, also im Prozess der Umsetzung von fachlichem und fachdidaktischem Wissen zum Schulstoff, genau geschieht. Nur so kann gewährleistet werden, dass Neuerungen forschungsbasiert umgesetzt werden und der Praxis und letztendlich der Gesellschaft wirklich zu Gute kommen.
Wenn Lehrer:innen sich den Herausforderungen gewachsen fühlen, die sich ihnen in der Praxis stellen, können sie Schüler:innen dazu befähigen, kritisch und konstruktiv mit der Vielfalt an Weltanschauungen umzugehen – was in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierungen von grösster Bedeutung ist.